Eine Cyberpunk-Noir-Geschichte
Es war immer noch bitterkalt am morgen, auch wenn der Winter seinen Zenit bereits überschritten hatte. Ich stand also leicht frierend vor dem Cyaltco-Stadtkrankenhaus und rauchte mit roten Fingern die zweitletzte Zigarette aus der Schachtel. Ich blickte auf die Uhr. Ich fragte mich, ob sie mich noch erkennen würde. Ich fragte mich, ob ich sie erkennen würde. Feuchter Atem gefror vor meiner Nase.

Hatte ich die tatsächliche sie jemals gesehen oder war alles nur Gaukelspiel und Trug gewesen? Es ist peinlich zuzugeben, aber ich gestehe, ich fühlte mich in diesem Moment wie ein Teenager vor dem ersten Date, obwohl dieser Gedanke natürlich abwegig war. Ich wollte sie nur noch einmal sehen, sichergehen, dass sie sich erholt hatte und keine Narben davontragen würde. Das sagte ich mir zumindest. Und so wartete ich an der Tür meines roten Fords lehnend, während meine Augen – dieses Mal hatte ich meine Kontaktlinsen nicht vergessen – ungeduldig den Eingang zum Krankenhaus observierten. Die roten Buchstaben über den gläsernen Schiebetüren flackerten unstetig. Und schließlich, als ich schon glaubte, sie würde gar nicht mehr kommen, schritt sie durch eben jene Tür.
Sie stand da – sie war etwas zittrig und steif – aber ich erkannte ihre zierliche Gestalt sofort. Diese schwarz gefärbten und halbkurz geschnittenen Haare Jerikas, diese grünen Augen Lucys, ich würde sie nie vergessen. Und zu meiner gänzlichen Überraschung winkte sie mir zu. Ich blickte mich zuerst um und nahm an, dass sie einen anderen meinte, aber ich war alleine auf diesen Stufen – mit ihr. Ich winkte zurück und schritt zu ihr rüber. Sie zitterte wirklich. Denn es war kalt und sie trug nur ihre Arbeits-Uniform, ohne die Jacke, die wir uns gegenseitig gegeben hatten. Ihre Augen aber leuchteten auf, als sie mich sahen und ihr roter spröder Mund verzierte ein schüchternes Lächeln. Sie erkannte mich. Mein Herz schlug bis zum Hals. Sie erkannte mich wirklich.
»Ich… hatte irgendwie gewusst, dass Sie auf mich warten würden.«
»Vor zwei Tagen kam die Nachricht… dass Sie aufgewacht sind, meine ich. Die Ärzte hatten nur meinen Kontakt und ich wollte sichergehen, dass es ihnen bei der Entlassung auch wirklich gut geht. Falls Sie wollen, bring ich Sie nach Hause. Oder wohin auch immer. Sie müssen es nur sagen.«
»Das ist wirklich lieb von Ihnen… Danke… Caballero.«
Ihre Beine knickten urplötzlich ein und sie fiel in meine Arme.
»Tut… tut mir leid…«, stammelte sie sichtlich errötend. »Ich bin noch… ganz schwach und ich glaube nicht…«
»Beruhigen Sie sich, Miss Keller. Der Mutant war tief in Ihnen vergraben. Sie werden heilen, aber das braucht seine Zeit.«
Als sie in meinen Armen lag und ich das rote Schimmern durch ihre schwarz gefärbten Haare sah, da wusste ich, dass ich Lucy in den Armen hielt. Sie war die Alte und doch war sie vollkommen neu und überraschend. Ich hatte sie gekannt, aber natürlich war der Schleier des Mutanten über ihr gelegen und so hatte ich sie nur wie durch Milchglas gesehen. Sie blickte zu mir auf. Ihre grünen Augen starrten forsch.
»Darf ich Sie etwas persönliches fragen?«
Ich stellte sie behutsam wieder auf ihre Beine und schüttelte den Kopf.
»Wenn Sie keine Antwort erwarten.«
»Sind Sie ein Engel?«
Ihre spitze Nase färbte sich bereits rot unter der klirrenden Kälte, fasziniert betrachtete ich ihr Gesicht, alle ihre Merkmale: die verstreuten Sommersprossen, die hohen Wangenknochen, der zur Schnute geformte Mund sowie das kleine Grübchen an ihrem Kinn.
»Ich schulde Ihnen viel«, fuhr sie fort und nickte und überging gnädigerweise mein unhöfliches Starren. »… Ich schulde euch viel. Was ist mit Ihrem Kollegen… Herrn Decker? Ich hoffe…«
Ich schüttelte den Kopf.
»Das… tut mir leid… Ich werde seine Aschestelle besuchen, wenn ich… wieder richtig gehen kann.«
»Das müssen Sie nicht tun, Mrs. Keller. Decker – Mein Kollege, er hatt letztlich nur seine Arbeit getan.«
»Das tut aber nicht jeder.« Lucy lächelte traurig. Und wieder einmal überraschte mich ihre Stärke. Ich hatte von anderen Überlebenden des Mutanten-Gen gehört, sie waren allesamt im Irrenhaus oder für immer seelisch vernarbt. Der Umbau des Körpers, die Penetration der Seele, die schmutzige Hand eines anderen Willens direkt am Herzen – kaum ein Mann war stark genug eine solch traumatische Erfahrung zu verarbeiten und doch stand hier Lucy vor mir, zittrig und angeknickt, aber nicht gebrochen. Ein Löwenzahn der Beton zerbrach.
»Erholen Sie sich einfach gut. Das würde auch mein Kollege wollen. Es ist unsere Aufgabe sie zu beschützen, immerhin.«
»Ehrlich gesagt, ich weiß nicht einmal wovon ich mich erholen sollte. Was habe ich eigentlich überlebt? Ich… erinnere mich. Aber es erscheint keinen Sinn zu geben. Die Bilder sind verwaschen und ohne Farbe. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann fühle ich nur so eine tiefe Leere in meinem Herzen… Ach, Mr. Caballero, es tut mir leid, ich rede Unsinn. Sicherlich. Und doch sehne ich mich nach Antworten. Was habe ich gesehen und gehört? Was hat mir das angetan? Ich…«
Sie verbarg ihre Wut gut. Aber ich hörte das Trommeln ihres Herzens unter der weißen Haut.
»Sie haben den Tod überlebt. Machen wir es nicht unnötig kompliziert, Miss Keller. Freuen Sie sich darüber und gehen Sie weiter. Ohne Angst.«
»Mehr haben Sie dazu nicht zu sagen, Mr. Caballero?«
»Ich unterliege einem Schweigegelübde. Doch selbst wenn ich Ihnen etwas sagen könnte, würde es Ihnen nur schaden. Es ist gut für Sie, dass Sie wenig wissen. Curiositas strangulierte schon so manche Katze.«
Ich sah den plötzlichen Anflug von Sorge in ihrem Gesicht.
»Keine Sorge, Miss Keller, Sie haben nichts zu befürchten. Was meinen Arbeitgeber angeht, sind Sie kein kritischer Faktor.«
Die Flügel ihrer spitzen Nase blähten sich auf. Ihre grünen Augen blitzten unnachgiebig und da erinnerte ich mich, an das was Decker mir empfohlen hatte. Ich seufzte. Und sie sagte:
»Ich bin kein Tratschweib, Mr. Caballero. Ich will nur den Grund meiner Albträume erfahren. Habe ich denn dazu kein Recht?« Ihr Ton machte deutlich, dass sie keinen Widerspruch dulden würde.
Ich bot ihr eine Zigarette an. Sie nahm dankbar an.
»Es sind Feinde der Realität.«
Lucy trat einen Schritt zurück. Sie blickte verwirrt zu mir empor.
»Das verstehe ich nicht.« Ein verlegenes Lächeln zeigte sich nun auf ihrem Gesicht und sie strich sich eine ihrer Strähnen aus dem Antlitz. Darunter kam verschmiertes schwarzes Makeup unter den Augen zum Vorschein. Es war das gleiche wie an jenem Morgen. »Ich meine, ich verstehe, warum Menschen oft kämpfen und sich gegenseitig verletzen. Sie hungern oder hungern nicht und wollen einfach mehr. Oder Sie wollen irgendetwas beschützen, was ihnen gefällt oder zerstören, was ihnen missfällt. Das verstehe ich. Ich habe es selbst gesehen – in Midwest. Aber was hat die Realität diesen… Monstern getan?«
»Es ist eine Interpretationsfrage, Miss Keller. Mauern können als das Fundament eines wohnlichen Hauses gesehen werden. Hinter ihnen haben wir es warm, wir sind beschützt und sicher vor wilden Tieren und den Elementen. Es gibt aber nun wiederum… Andere, die diese Mauern als Gefängnis betrachten. Es gibt viele Namen für sie, aber wir kennen sie als Mutanten – diejenigen, die diese Mauern niederreißen und das Gebäude über unseren Köpfen zum Einsturz bringen wollen.«
»Und sie haben sich entschlossen, dieses Haus also zu beschützen. Haben Sie denn keine Furcht, ein Gefangener zu sein? Vielleicht haben diese… Mutanten ja recht?«
Mein Blick sagte wohl mehr als tausend Worte. Sie stotterte nervös.
»Ich meine… ich will das Opfer, dass ihr… Sie und Ihr Kollege geleistet haben nicht schlechtreden. Aber ich… ich erinnere mich. Ich war so überzeugt und es schien mir alles gut und vernünftig damals… als ich…«
»Nein«, erwiderte ich harsch und schüttelte den Kopf. »Wenn das Freiheit ist, was die Mutanten suchen, dann ist es die Freiheit, die ein Astronaut fühlt, wenn er seinen Helm im Vakuum abnimmt. Freiheit ist zu leben. Der Tod ist ein Gefängnis. Er ist kalt und einsam und leer und sinnlos. Ich fürchte ihn, das muss ich gestehen, Miss Keller. Ich vertraue deshalb darauf, dass der ursprüngliche Erbauer dieses Hauses mir genau die Freiheit gibt, die ich brauche. Sie dürfen mich dafür gerne kindisch oder auch feige nennen. Ich bin es gewohnt.«
Lucy lächelte bitter und es wahr das reinste, was ich jemals in meinem Leben gesehen hatte. »Mr. Caballero, sicherlich sind sie wie alle Männer furchtbar kindisch, aber feige wie die meisten darf Sie niemand nennen. Ganz bestimmt nicht ich… zumindest. Immerhin stehen Sie hier vor mir.«
Urplötzlich wurde ich von einem kindischen Drang zur Wahrheit übermannt. Ich sagte:
»Ich heiße nicht Caballero.«
Lucy nahm einen Zug an der Synth. Der würzige Rauch brandete gegen mein Gesicht und wärmte die gefrorene Oberfläche, brachte kleine Eiskristalle auf der künstlichen Haut zum schmelzen.
»Wir geben uns selbst keine Namen. Sie werden uns aufgezwungen. Ich nenne Sie Caballero. Also heißen Sie so. Tut mir leid.« Sie zuckte mit den Schultern.
»Dann darf ich Sie Lucy nennen.«
Erneut lächelte sie und dieses Mal war keine Bitterkeit darin.
»Soll ich Sie nun nach Hause bringen?«, fragte ich, denn ich wusste nicht, was sonst noch zu sagen war.
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Ich darf nicht nach Hause. Noch nicht.«
»Warum nicht?«
»Ich kann es nicht ertragen«, sagte sie und der spitze Absatz ihrer Heels würgte das Leben aus dem glimmenden Zigarettenstumpf. »Vielleicht werde ich es nie ertragen. Wahrscheinlich nie. Ich… Sie… ich bin ein Monster gewesen. Ich habe Menschen verletzt und getötet und ich… manchmal schmecke ich das Blut immer noch auf meiner Zunge. Es ist so süß und…« Ihre Augen trübten sich mit stummen Tränen und eine tiefe Wehmut lag nun in ihrem Blick. »Ich bin ein Mörder, Caballero, ich kann nicht nach Hause. Ich sollte in Sing Sing sein, wie diejenigen, die sie Rejects nennen. Ich glaube… Nein, ich muss mich den Behörden stellen.«
Ich legte meine Hand auf ihre Schulter, doch das brachte sie nur mehr zum Zittern. Aber ich zwang ihre Augen in die meinen zu schauen und ich redete eindringlich zu ihr:
»Reden Sie keinen Unsinn. Diese Taten… Das waren nicht Sie. Sie sind nicht böse, Lucy.«
»Aber ich habe das Böse in mich gelassen. Ich erinnere mich an diesen… Stern. Ich… Es war alles so dunkel, nach… dieser Sache in Midwest. Ich war auf der Flucht. Das haben Sie richtig erkannt. Und das zurecht. Es war passiert und ich war allein und auf einmal war da Licht und es war warm und ich habe nicht weggesehen. Ich habe es stattdessen in mich gelassen.« Lucy schüttelte den Kopf und legte ihre Arme um ihre Schultern. »Ja, das ist die Wahrheit, Caballero«, sagte sie und blickte zu Boden. »Ich bin kein guter Mensch. Ich weiß nicht, wofür Sie mich halten, aber ich bin es nicht. Nein, ich bin etwas ganz anderes. Ich war schon böse, lange bevor.« Ich schob ihr Kinn nach oben und ich sah die Tränen in den Augen glitzern.
»Wir alle sind gleich, Lucy. Niemand ist immun, gegen das, was sie besessen hat. Nicht Sie, nicht ihre Kollegen und auch nicht ich. Doch es gibt einen Unterschied zwischen denjenigen, die Kämpfen und denjenigen, die aufgeben. Und Sie gehören sicherlich nicht zu der Sorte, die sich schämen muss.«
Lucy schien nicht zu verstehen. »Sie müssen wissen, das Mutanten-Gen nistet sich normalerweise tief im Menschen ein. Es wandert durch die Kehle und die Speiseröhre in den Magen. Von dort geht es in den Darm und hakt sich fest und legt Eier und gebiert unzählige Tumore. Aber ihr Wurm war noch im oberen Rachen.«
Sie sagte immer noch nichts.
»Das heißt, Sie haben diesen Wurm immer wieder hochgewürgt. Nur deshalb konnte ich ihn herausziehen.«
Lucy setzte sich auf die Treppenstufen und bedeutete mir mit ihren Händen dies ebenfalls zu tun. Als ich mich zögerlich aber gehorsam gesetzt hatte, legte sie ihren Kopf an meine Schulter. Ich spürte das kratzen ihrer Haare und die Wärme ihrer Wange. Ihr ruhiger Atem schuf weiße Wolken in der kalten Luft. Für eine Weile schwiegen wir und sahen zu, wie die ersten Anzeichen der Morgenröte sich durch die östlichen Hochhausschluchten allmählich zaghaft vortasteten. Schließlich seufzte sie. Und ich muss gestehen: ich erschrak als sie plötzlich meinen Kopf nahm, ihn drehte und so trafen sich unsere Augen näher als jemals zuvor.
»Wenden Sie ihre Augen nicht ab, Caballero. Sie haben hübsche Augen. Es ist eine Sünde, der Welt Schönes vorzubehalten.«
Ich entfernte meine Kontaktlinsen.
»Das sind nicht meine Augen.«
»Habe ich meine Augen etwa selbst gemacht?«, fragte sie und ich schüttelte den Kopf.
» – Hach, ist es nicht schade«, sagte sie und entließ mich endlich aus den Fesseln ihrer vollen Lippen.
»Was?«, fragte ich und war tief verwirrt.
»Alles. Einfach alles.«
»Man kann nicht alles schade betrachten. Um manches ist es wirklich nicht zu schade«, sagte ich. Sie grunzte erstaunlich unfeminin. Sie stand auf. Ich tat es ihr gleich und sie lehnte sich erneut an meine Schulter.
»Wissen Sie was, ich habe jetzt einen Mordshunger, Caballero.«
»Ich glaube, ich habe ihn gehört.«
Sie grunzte erneut – relativ flegelhaft und ganz und gar nicht Damen-gleich.
»Ach, Caballero«, sagte sie und klang nun teils amüsiert teils verbittert und teils wütend. Ich verstand sie nicht. »Sie sind tatsächlich furchtbar kindisch.«
»Das tut mir leid, ich kann wirklich nicht mehr sein, als ich bin.«
»Wenn das so ist: Dann will ich wissen, wer Sie sind. Wollen Sie denn nicht wissen, wer ich bin?«
Ich drehte meinen Kopf zu ihr und zwang ihren Kopf rüde aus der bequemen Lage meiner Schulter. Ihre grünen Augen glitzerten wie Kristalle und zeigten tausend verschiedene Farben.
»Ist das denn überhaupt möglich?«
Sie kicherte nun offen und hielt ihre schlanken Finger vor den weiß blitzenden Zähnen.
»Wie gesagt: ich habe jetzt Hunger. Wollen wir einen Happen zum Beißen greifen? Ich könnte jetzt ein ganzes Pferd aufessen!« Sie seufzte übertrieben auf und in diesem Ton sowie in der Note ihres Parfums lag nun ein leichter Duft von Rosen.
Ich bot ihr meinen Arm an. Erstaunlich elegant – wie eine Lady, wie meine Lady – hakte sie sich unter.
»Es wäre mir ein Vergnügen, Madam«, sagte ich.
Und zusammen aneinandergelehnt hinkten wir zum roten Ford – zwei versehrte Veteranen.
»Oh, Mr. Schick, da ist ein Kratzer an Ihrem Wagen«, sagte sie.
»Ich werd´s reparieren«, erwiderte ich.
Wir stiegen ein und der knatternde rote Blitz trug uns über die Straßen und unter der Wärme einer aufgehenden Sonne schmolzen langsam Schnee und Eis. Wir verließen das Viertel über den Intra-City-Highway und am Ausgang blinkten immer noch die alten Neonbuchstaben.
Links:
Beginn der Geschichte: https://styxhouse.club/2024/03/24/switch-head-switch-on-teil-1/
Vorheriges Kapitel: https://styxhouse.club/2024/08/10/switch-head-switch-on-teil-9/
Neugierig auf mehr bizarre Geschichten? Kaufe hier mein Buch!
und
Amazon:
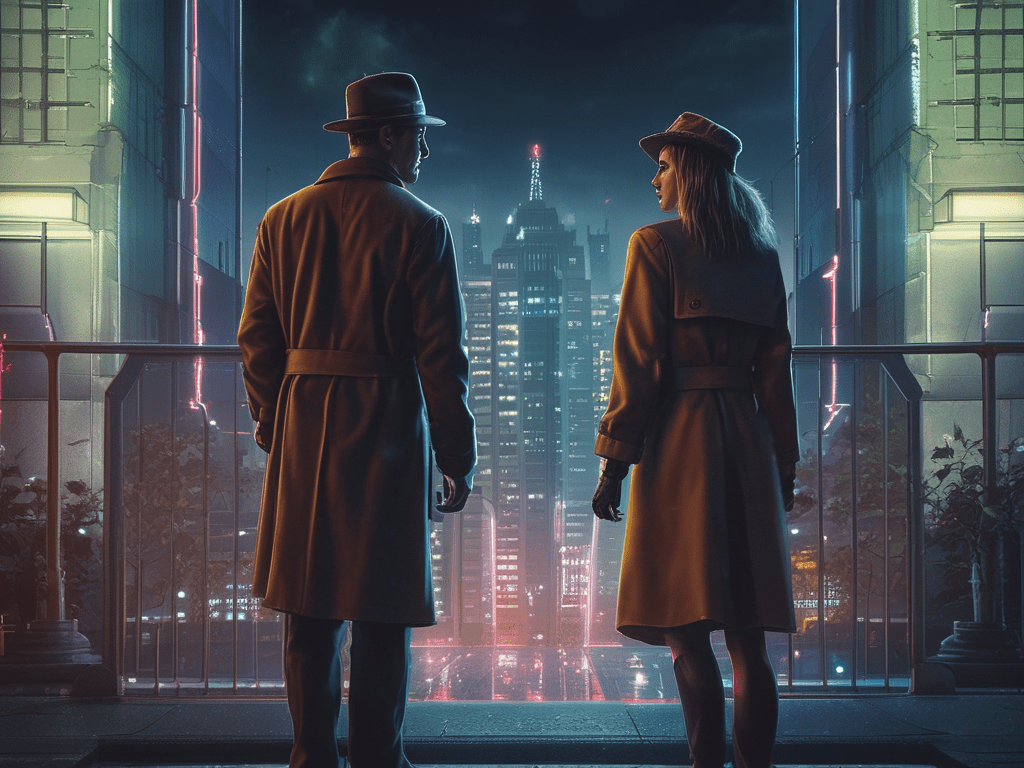
One thought on “Switch Head!! Switch On!!! Teil 10”